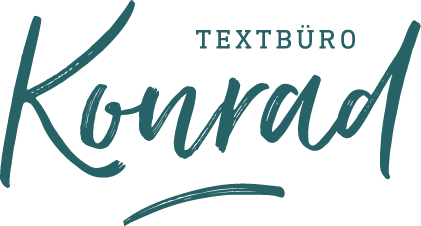Tschüss Genderstern? Bitte nicht!
Am 24. November entscheidet die Stadtzürcher Stimmbevölkerung über die Volksinitiative «Tschüss Genderstern!». Diese will der Stadtverwaltung verbieten, in ihrer Kommunikation Sonderzeichen zur sprachlichen Inklusion innerhalb einzelner Wörter zu verwenden. Neben dem Genderstern (Lehrer*innen, Polizist*innen) soll auch der Doppelpunkt (Lehrer:innen, Polizist:innen) verboten werden.
Seit 2022 richtet sich die Stadtverwaltung bei der schriftlichen Kommunikation nach einem Sprachreglement. Es schreibt den Verwaltungsmitarbeitenden den Genderstern oder geschlechtsneutrale Wörter vor. Das Ziel des Reglements besteht darin, alle Geschlechter sprachlich gleichberechtigt zu behandeln: Frauen, Männer und non-binäre Personen.
Nun soll also auf eine sprachliche Gleichstellung in der Zürcher Stadtverwaltung verzichtet werden, sie soll gar verboten werden. Im Manifesto von macht.sprache, einer Website, die beim Umgang mit mit politisch sensibler Sprache unterstützt, schreibt Lann Hornscheidt – sprachwissenschaftlich und verlegerisch tätig: «Wer sich gegen sprachliche Veränderungen wehrt, sollte sich fragen, für wen diese Veränderung unbequem ist, für wen die Formulierung unschön ist – und für wen die etablierte Norm das Leben weniger lebenswert macht. Politisch unsensible Sprache verursacht Schaden. Politisch sensible Sprache ist wichtig, weil sie dazu beitragen kann, Verletzungen zu vermindern. Außerdem kann ein sensibler Umgang mit Sprache Verunglimpfungen und Respektlosigkeiten als solche sichtbar machen.»
Ein gibt ein gutes Beispiel, das einfach veranschaulicht, dass Sprache einen Einfluss darauf hat, was wir uns vorstellen: Vater und Sohn sind mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem beide schwer verletzt werden. Der Vater stirbt während der Fahrt zum Krankenhaus, der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick jedoch erblasst einer der diensthabenden Chirurgen und sagt: «Ich kann ihn nicht operieren – das ist mein Sohn!» Wer ist dieser Chirurg in der Geschichte? Es ist die Mutter. Die Geschichte verwirrt im ersten Moment, da wir uns – wenn von einem «Chirurgen» die Rede ist – sofort einen Mann vorstellen. Und keine Frau. Im Englischen kann ein «teacher» ein Mann oder eine Frau sein. Im Deutschen wird nach grammatikalischem Geschlecht unterschieden in Lehrer und Lehrerin. Zu meiner Schul- und Unizeit stand bei jedem Aufsatz ein Hinweis, dass bei der männlichen Form die weibliche mitgemeint ist. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Oder nicht?
Die geschlechtergerechte Sprache ist eine Umstellung und der Umgang mit dem Gendersternchen oder dem Doppelpunkt kann umständlich sein. Das Gendering bringt auch beim Textbüro Konrad Herausforderungen. Zu viele Personenbezeichnungen mit Doppelpunkten in einem Satz können die Lesbarkeit erschweren. Und der Einwand, dass beispielsweise die Form «Ärzt:innen» den männlichen Arzt nicht enthalte, mag gerechtfertigt sein. «Kund:innen» scheint grammatikalisch nicht korrekt, denn es gibt ja den Begriff «Kund» nicht. Aber beim generischen Maskulin ist die weibliche Form nicht mitgemeint. Denn werden Frauen sprachlich nicht abgebildet, so werden sie eben häufig doch nicht mitgedacht. Dies zeigt sich deutlich am Beispiel mit dem Chirurgen.
Übrigens sind bei Sprachen wie Swahili, Usbekisch, Armenisch, Finnisch oder Türkisch weder Substantive noch Pronomen geschlechterspezifisch. Eine einfache Lösung für eine geschlechtergerechte Sprache ist noch nicht in Sicht. Ein Verbot des Genderstern ist aber sicher nicht die Lösung.